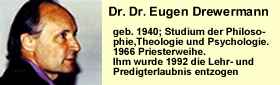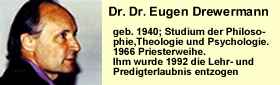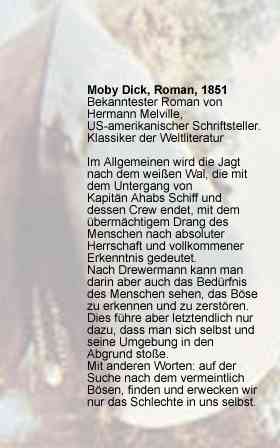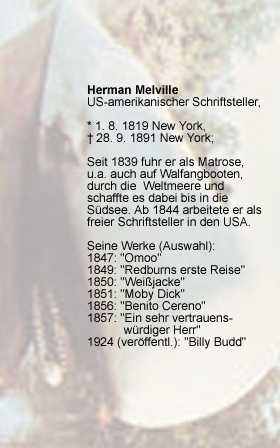"Wer das Buch Jona
versteht, versteht das gesamte alte Testament", beginnt Eugen Drewermann
am 10.10.2001 in der Urania
seinen Vortrag über das 10 prophetische Buch "Jona" des alten Testaments.
Wer also die Botschaft dieser 3 Seiten begriffen hat, verstehe auf
welchen (einfachen) Grundlagen nicht nur das Judentum, sondern somit
auch das Christentum und der Islam stehen.
Eugen Drewermann, der Ende der 90er Jahre vor allem bekanntgeworden
ist durch den Streit über die Abtreibungsfrage mit dem damaligen Paderborner
Erzbischof Degenhardt (mittlerweile zum Kardinal ernannt), setzt sich
für eine kritisch-historische Erforschung und Deutung der Bibelgeschichten
ein. Denn die Bibel ohne Kritik, ohne geschichtliche Zusammenhänge,
ohne gesellschaftliches Bewußtsein wirke wie Gift. Eine Bibel-"Deutung"
nach Art der katholischen Führungselite, wo Jungfrauengeburt Jungfrauengeburt,
Auferstehung Auferstehung, eine Wundertat eine Wundertat ist, zerstöre
den Glauben. Schlimmer noch, kann man fortsetzen, eine Auffassung
über ein religiöses Bekenntnis, die dieses "prinzipiell" über andere
Bekenntnisse stellt, wie manche Bischhöfe nach
Ansicht Drewermanns meinen und der Repräsentant dieser Religion,
mithin also auch der Urahn jedes einfachen Christen, der übermenschlich
ist, fördern Intoleranz, Arroganz und Ignoranz gegenüber fremden Glauben
und in Folge, gegenüber fremden Kulturen. Und so müsse man auch
das Buch Jona und alle übrigen Bibelgeschichten verstehen: als Dichtung,
die im historischen Sinne falsch sei, auf einer anderen Ebene aber
Wahrheiten transportiere. Wahrheiten über den Menschen im Allgemeinen,
über das Selbst, über das Zusammenleben von Menschen. Als symbolische
Ausdrücke von utopischen Zuständen, von Wünschen auf eine bessere
Welt, aber auch von Elend und menschlichen Unzulänglichkeiten, die
häufig eingebettet sind in (verfremdete) historische Kontexte und
Ereignisse. Worum geht es im Buch Jona?
Und warum nimmt diese kleine Geschichte für Drewermann eine zentrale
Stellung in der Bibel ein?
Es geht,
ganz allgemein, um die Erkenntnis des eigenen Selbst und dessen Akzeptanz
als Grundlage für Menschlichkeit.
Eine prähistorische
Satire
Drewermann las den Text des Buches Wort für Wort vor, bat aber darum,
weniger auf den Inhalt zu achten, als mehr auf den Schreibstil und
die Gefühle, die dadurch in einem selbst ausgelöst werden. Unweigerlich
achtet man aber nun doch auf den Inhalt, gerade wenn man die Geschichte
noch nicht kennt. Und auch in Anbetracht eines Schreibstils, der mit
unserer heutigen Prosa nicht mehr zu vergleichen ist, ist es schwer,
überhaupt ein Gefühl beim Lesen oder Hören des Textes zu gewinnen;
ein Umstand, der sicher auch auf die anderen Bibelgeschichten zutrifft
und ein Grund sein könnte, weswegen man vor der Lektüre der Bibel
eher zurückschreckt. So wie heute in Bezug auf z.B. Artikel in Zeitungen,
führte Drewermann aus, sei auch bei den Bibelgeschichten das Genre
oder der Stil, in denen sie überliefert sind, von großer Wichtigkeit.
Denn die Bedeutung eines Textes sei stark abhängig davon, in welcher
Form er erzählt wird: ob als reiner Prosatext, ob als Gedicht, als
Märchen oder als Satire - der Inhalt kann der gleiche sein, aber die
Bedeutung wandelt sich. Das Buch Jona sei in einfachster, fast naiver
Sprache verfasst, jedoch voller zum Teil sarkastischem, aber liebevollem
Hintersinn; wenn das Buch heute geschrieben worden wäre, wäre wahrscheinlich
ein satirischer Essay herausgekommen. Und tatsächlich, nachdem Drewermann
uns diese Deutung gegeben hat, sah ich den Text aus einer anderen,
vielleicht weniger Bibel-respektvollen, Perspektive.
Jona ist schon eine ziemlich lächerliche Figur: erst flieht er vor
seiner Verantwortung, den Heiden in Ninive zu predigen ausgerechnet
auf ein Schiff, dass nur so von Heiden wimmelt, dann verschließt er
die Augen vor dem Unvermeitlichen (legt sich zum Schlafen hin), will
dann lieber sterben und schließlich, als er im Grunde das erreicht
hat, was er wollte und im Bauch des großen Fisches von allen und jedem
für alle Zukunft zufrieden gelassen werden kann (oder um es tiefenpsychologisch
zu deuten: den Raum der tiefsten Sehnsucht des Menschen gefunden hat
- der Fischleib als Sinnbild für den Mutterleib), empfindet er diesen
Zustand plötzlich als unerträglich (der Fischleib auch als Sinnbild
für den "Gefängnisraum der Verzweiflung") und will mit einem Male
doch das tun, was Gott ihm befahl. Doch nachdem er seinen Auftrag
ausgeführt hat, ist er immer noch nicht glücklich, ärgert sich darüber,
dass nur geredet und nicht gehandelt wird und verfällt am Ende in
eine lebensverneinende zornige Grundhaltung. So gesehen muss man sich
wirklich fragen, ist dieser Mensch eigentlich jemals zufrieden mit
dem, was er tut?
Die Bedeutung
Gerade hinter dieser permanenten Unzufriedenheit Jonas und seiner
lächerlichen Existenz verbirgt sich die Botschaft der Geschichte.
Jona sind wir. Jona ist der Mensch, der permanent vor sich selber
flieht, nicht wahr haben will, wie er wirklich ist, seine innersten
Bedürfnisse und Bestrebungen nicht anerkennt, weil sie ihm irgendwie
nicht in den Kram passen oder der etwas anderes darzustellen versucht,
als er ist. Oder in den Worten von Albert Camus, den Drewermann mehrmals
zitiert: ein Mensch, der sein innerstes Ich nicht anerkennt, lebt
eine "Jona-Existenz". Dass aber eine Erkenntnis und Anerkennung des
eigenen Selbst nicht so einfach ist wie es zunächst erscheint, zeigt
sich spätestens in Jonas Reaktion auf Gottes ausbleibende Taten. Denn
etwas tun oder auch eine Einstellung zu etwas entwickeln bedeutet
noch lange nicht, auch mit voller innerster Überzeugung dahinter zu
stehen. Denn wenn man wirklich zu dem Menschen geworden sei, der man
ist, werde man zum wahren Christen (und man kann ergänzen, zum wahren
Juden, Moslem, Hinduist...), so Drewermanns Folgerung. Das bedeutet,
man handele, wie Gott es in dem Fall der Jona-Geschichte tut: mit
Barmherzigkeit, Verständnis und Toleranz gegenüber anderen Menschen.
Dann zählten Attribute wie Beruf, Herkunft, Nationalität, Glauben,
Geschlecht, Alter usw. als Bewertung des Menschen nichts mehr.
Diese Deutung der Jona-Geschichte beantwortet im Grunde die Frage,
um die der Vortrag die ganze Zeit kreiste: "Wie ist wirklicher christlicher
Glaube zu greifen und zu ergreifen?" Schließlich werden wir alle von
Geburt an, durch die "Taufgnade", sozusagen automatisch zu Christen;
das Christ-Sein ist naturalisiert. Aber wozu führt das Verständnis
eines Gnadentums von Geburt an ohne einen Werdeprozeß? Es führt zu
einem Exklusivitätsdenken: Wir (die Christen,...) vertreten die Wahrheit,
wir sind im Recht, wir sind die besseren Menschen usw.; es führt dazu,
dass man sich im Recht (Gottes) wähnend, Unrecht tut.
Der Schritt zu den aktuellen Ereignissen ist nur klein und lag während
des gesamten Vortrags förmlich in der Luft. Drewermanns Stellungnahme
dazu war dann auch eindeutig: "Unendliche Gerechtigkeit paßt nicht
auf endliche Menschen", "sind wir denn himmlische Chirurgen, die das
Böse im OP beseitigen" oder den Roman Moby
Dick heranziehend, der nach Meinung Drewermanns einige
Parallelen zu dem Buch Jona aufweise: "es ist nicht möglich, das Böse
zu jagen und zu bezwingen", man sorge dadurch nur für seinen eigenen
Untergang.
Der Vortrag
Ein sehr beeindruckender Vortrag, in dem Drewermann sprunghaft von
einem emotionalen Zustand in den entgegengesetzten wechselte; von
einem extrem sanften, fast etwas naiven, Mitleid mit den "einfachen
Menschen", die in ihrer Orientierungslosigkeit häufig "einfach
nicht wissen, wo recht und links, gut und böse ist", bis hin zu einer
bissigen Wut gegenüber der Unbeweglichkeit, Arroganz und Intoleranz
vieler Kirchenvertreter. Auch ein Vortrag, der sehr informativ war,
vor allem deswegen, weil Drewermann viele Seitenblicke auf andere
literarische Werke warf, auf Camus, Kirkegaard,
Melville
und für den der historische Kontext wichtig ist. Mich beeindruckte
vor allem Drewermanns Sprache und Sprachstil: Einerseits sehr erzählerisch-informativ,
so dass man gerne und leicht folgen konnte, andererseits sehr weich,
harmonisch und "friedfertig". So ist sein Stil auf einer
ungewohnten, manche würden vielleicht einfach sagen: pastoralen, Sprachebene
anzusiedeln und unterscheidet sich angenehm von dem, was man, gerade
in jüngster Zeit, überall zu hören und zu lesen bekommt. Ich denke,
eine solche Sprache sollte öfter gesprochen werden. Sie würde uns
vielleicht ja auch eine andere Sicht auf die aktuellen Ereignisse
erlauben, ohne dass man beim Diskutieren über Krieg und Frieden als
Vertreter der zweiten Position ständig in "Argumentationsnot" gerät,
wenn es um die Frage geht: "was würdest du denn tun?"
Zur nächsten Arbeitsprobe
Zurück